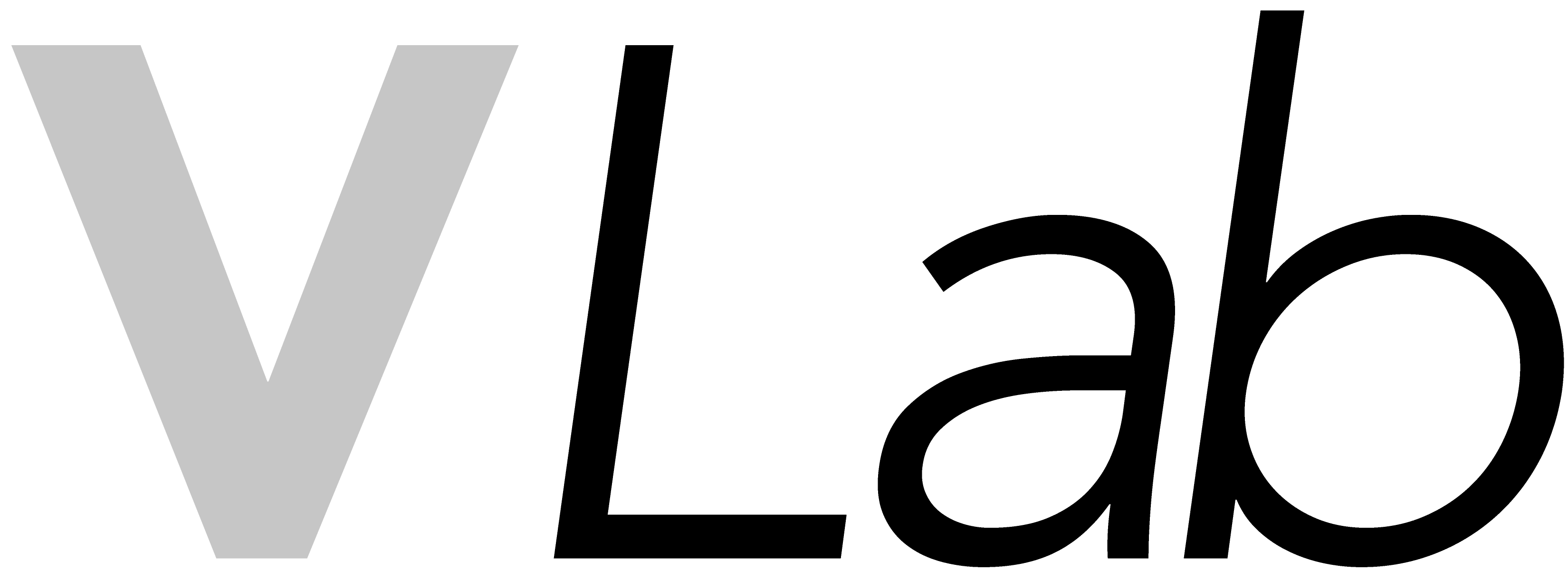Nennt mich nicht fremd
Die Macht über Namen und meine Machtübernahmen
„Võ Tố Trinh“, „武 素 貞“
Auf meinem Laptop habe ich ein Word-Dokument abgespeichert, in dem meine zwei nicht-deutschen Namen abgespeichert sind. So kann ich ihre richtige Schreibweise jederzeit nachschauen.
Als meine Eltern auf der Suche nach einem Namen für mich waren, stand fest, dass es drei werden würden. Zwei, mit denen sie mich in ihren jeweiligen Muttersprachen rufen würden und einen für die Geburtsurkunde und die deutsche Mehrheitsgesellschaft, die sich ihre Namen nicht merken konnte und diese mit viel zu harten Konsonanten und den falschen Tönen radebrach. Nicht nur wollten sie mir diese spezifische Erfahrung ersparen, sondern auch viele kleine und große Herabwürdigungen, die in diesem Land oft im Schlepptau mit ihr kamen. In ihrer Entscheidung lag die Hoffnung, dass dieses Entgegenkommen den zukünftigen ErzieherInnen, LehrerInnen und ChefInnen ihrer Tochter gegenüber dazu führen würde, dass diese sie eher akzeptieren und respektieren würden. Durch Anpassung wollten sie mir die Ausgrenzung ersparen, mit der sie selbst so oft konfrontiert waren. Die mangelnde Solidarität und ja, auch den Rassismus.
Meine Erfahrung von Rassismus drehte sich daher von Geburt an um Namen. Namen prägen Identität. Meine wurde stets vom Ringen um den richtigen Namen geprägt.
„Jaja, das meinte ich nicht. Woher kommst du wirklich?“
Diese Frage folgte jedes Mal, sobald ich als Teenagerin begann mich „deutsch“ zu nennen. Sie verfolgte mich geradezu. Wildfremde Menschen unterstellten mir, ich hätte ihre ursprüngliche Frage nicht richtig verstanden und meinten, sie müssten sie nur noch mal mit Nachdruck wiederholen, um klarzustellen, dass ich nicht „richtig deutsch“ sein könne und dass sie anders als ich in der Position seien dies zu bestimmen. Oft meinten sie damit, dass ich mehr geduldet wurde als als Teil der Gesellschaft respektiert. Dieser mangelnde Respekt wurde in ihrem gedankenlosen Wegwischen meiner Selbstbezeichnung deutlich. Unter ihrer exotisierenden Neugier wurde meine Existenz in meiner Heimat nur zu Bedingungen gewährt, ständig gefährdet. Sie bewahrheiteten damit eine Hoffnung meiner Eltern, vor der es mir zunehmend graute. Durch meine akademische Leistung als Teil einer tiefgreifenden Assimilation, der meine Muttersprachen beinahe zum Opfer gefallen sind und die dazu führte, dass ich als Kind erschrak wenn ich in den Spiegel sah und kein blondes Mädchen sah, legitimiere ich in ihren Augen meinen Aufenthalt. Häufig brachten sie diese Haltung unmissverständlich zum Ausdruck, indem sie sich in meinem Beisein über andere ethnische Gruppen beschwerten und sich wünschten, sie würden verschwinden. Dies dicht gefolgt von aufgerissenen Augen und der Beteuerung: „Aber dich meine ich damit natürlich nicht! Du sprichst super Deutsch!“. Was sollte ich daraufhin weiter entgegnen als ein abgekämpftes Lächeln, im Wissen, dass sie damit schon meine Eltern des Landes verweisen wollen?
Diese Wahrnehmung meiner Fremdheit schlug sich in vielen gutgemeinten Komplimenten nieder, wie dass „ihr Asiaten so fleißig“ oder „schlau“ seien oder „keine Probleme“ machten. Im Endeffekt machten diese jedoch nur eine einseitig gefühlte Kluft zwischen „uns“ und „euch“ auf. Bin ich wirklich integriert, wenn ich alle vorgeschobenen Bedingungen einer Gemeinschaft erfülle, dann aber ein ums andere Mal nur meine Andersartigkeit hervorgehoben wird? Nicht als Individualität, sondern Beleg für ein Stereotyp einer fremden Gruppe.
„Ching chang chong“
Ist die häufigste Beleidigung, die mir nachgerufen wird. Offen rassistische Witze und Sprüche waren und sind so normalisiert, dass kaum eine Augenbraue gehoben wurde und wird. Im Lauf der Jahre habe ich gelernt, dass ich zusätzlich kaum Schutz von denjenigen zu erwarten habe, die mich bereits als fremd markiert haben. Inzwischen verletzen mich weniger die Verwünschungen irgendwelcher Fremder auf offener Straße, als die mangelnde Solidarität unter verschiedenen Minderheiten und die ermüdenden Diskussionen mit Menschen meines Milieus oder sogar Freunden, ob es Rassismus überhaupt noch gebe. Ständig befinde ich mich in der Situation meine Haltung mit genauen persönlichen Anekdoten verteidigen zu müssen. Dabei sollte ich Angaben über die Häufigkeit, die Tageszeiten, den Ton oder das Aussehen der Täter machen, nur um, mein Erlebnis relativiert, meine Gefühle entwertet oder eine Mitverantwortung an den verbalen Übergriffen zugewiesen zu bekommen.
Die widersprüchliche Sonderstellung der „Modellminderheit“ verloren asiatisch gelesene Menschen wie ich dann schlagartig in der Corona-Pandemie. Von „fremd“ zu „fremd und minderwertig“ ist es schließlich nur ein kurzer Sprung wie meine Familie und ich mit dem Ausbruch der Infektionen schmerzlich erfahren mussten. Zu den Blicken, den gewechselten Gehsteigen und abgelehnten BlablaCar-Fahrten kamen zudem Medienberichten von körperlichen Attacken auf Menschen asiatischen Aussehens, sodass ich zum ersten Mal in meinem Leben nicht mit der Befürchtung beleidigt oder missachtet zu werden, sondern physisch angegriffen zu werden aus dem Haus ging. In dieser Situation lernte ich auch Empathie mit anderen Gruppen, die schon seit langem mit dem Stigma der potenziellen Gefahr leben. Ich war entsetzt über meine Ignoranz. Während ich in dem Wissen aufwuchs, dass viele Menschen mich für ekelhaft (mein Essen) oder lächerlich (meine Ethnie in den Medien) halten, waren andere mit der Möglichkeit konfrontiert, dass Menschen Angst vor ihnen hatten. Denn wer nur noch als Gefahr wahrgenommen wird, statt als Mensch, muss mit der Verletzung seiner Rechte rechnen. Mir wurde daher zum ersten Mal wirklich bewusst, wie wichtig die Repräsentation von Minderheiten als komplexe Menschen in den Medien aber auch die Bekämpfung des Alltagsrassismus ist. Nicht nur beraubt dieser Menschen wie mir das Heimatgefühl, seine Tolerierung toleriert unsere Entindividualisierung.
„halb-deutsch, drei Achtel vietnamesisch, ein Achtel chinesisch“
In meinem letzten Sommer der Grundschule machten wir einmal eine Exkursion zu einer Ausgrabung in der Burgruine, die über unserer Kleinstadt thronte. Ich habe bis heute eine lebendige Erinnerung daran, wie der Archäologe dort mich fragte, ob ich denn Vietnamesin sei. Obwohl ich mich selbst mit meiner Sozialisation in Deutschland immer weniger mit dieser Zuordnung identifizieren konnte, freute es mich, dass jemand wusste, dass China nicht das einzige Land in Ost-/Südostasien ist. Mit den günstigen Langstreckenflügen und der zunehmenden Popularität asiatischer Musik-, Fernseh- und Esskultur, wurde ich auch regelmäßig für eine Thai, eine Japanerin oder eine Koreanerin gehalten. Dabei fühlte ich mich mehr als eine Projektionsfläche der Interessen der Ratenden („Ich möchte mein Chinesisch üben!“, „Kannst du auch so toll kochen?“, „das Land der schönen Frauen“) als dass ehrliches Interesse an meiner Person bestand.
In meiner Jugend wich ich der Identitätsfrage aus, indem ich – nach meiner Herkunft gefragt – meine Biografie sowie die meiner Eltern herunterspulte. Dies tat ich so objektiv wie möglich, um so dem Fragenden zu überlassen, selbst zu beantworten, welcher Gruppe ich denn zugehöre. Warum? Nachdem ich so oft die Erfahrung gemacht hatte, dass meine Heimatstadt nicht die gesuchte Antwort war, ersparte ich mir so die schmerzvolle Ablehnung und den Konflikt, wenn ich nicht „mit der Sprache rausrücken wollte“. In Wahrheit finden diese Begegnungen nämlich selten in einem luftleeren sozialen Raum statt, indem ein gleichberechtigter Austausch von Informationen vollzogen wird. Es waren Menschen, von denen ich direkt oder indirekt abhängig war, die fragten. LehrerInnen, Vorgesetzte in Praktika oder Nebenjobs, in Bewerbungsgesprächen, im Kontakt mit PatientInnen. Natürlich hätte ich jedes Mal den Konflikt eingehen können, doch ich hatte resigniert. Während es für mein Gegenüber eine ärgerliche Situation war, war es für mich jedes Mal eine Erinnerung daran, dass es überall so viele Menschen gibt, für die ich nicht deutsch genug war. Diese haben Vorstellungen davon, wie ich aufgrund dessen zu sein habe („Komisch, dass du das nicht kannst. Du bist doch Chinesin“) oder wie ich mit dem Herkunftsland meiner Eltern umgehen soll („Du solltest deine Wurzeln kennen!“). Es dauerte lang, bis ich diese Mikroaggressionen als die Grenzüberschreitungen erkennen konnte, die sie sind. Ich hatte mich zu sehr an sie gewöhnt. Und daran, dass diese Menschen mich beurteilen und bewerten. Ich probierte damit dieselbe Strategie meiner Eltern: durch Anpassung der Ablehnung entgehen.
Mit dem vollständigen Familienstammbaum bewaffnet, hatte ich wenigstens den Eindruck etwas Individualität und Wahrheit in meine Stereotypisierung einbringen zu können. Pflichtbewusst kam ich ihnen also entgegen, um dem Konflikt zu entgehen. Und auch aus Angst, meine „Aufmüpfigkeit“ könne echte Konsequenzen nach sich ziehen. Auf die Idee mich der grenzüberschreitenden Neugier völlig zu verweigern, kam ich erst Anfang zwanzig.
„Ich bin deutsch“
Neben meinem Medizinstudium arbeitete ich in dem Blutabnahmeteam der Uniklinik mit. Dieser Job erforderte den Kontakt mit über zwanzig PatientInnen in jeder zweistündigen Schicht. Das bedeutete jedes Mal fast zwanzig Small-Talks.
Zunehmend genervt von den „Woher kommst du wirklich?“-Fragen stellte ich mich immer öfter dumm, um sie zu zwingen ihre Fragen so oft umzuformulieren bis sie nach dem richtigen Konzept fragten. Ich ging oft vor Wut schäumend von der Arbeit zur Vorlesung, aber immerhin hatte ich die Genugtuung, mein Gegenüber geärgert zu haben. Zumindest mussten sie sich überlegen, was genau sie denn wissen wollten, weil ich ihnen nicht mehr entgegenkam und ihnen unter Leugnung meines Zugehörigkeitsgefühls auf dem Silbertablett präsentierte, was ihnen anscheinend so wichtig war. Ich rebellierte gegen ihre Erwartungshaltung, dass ich doch schon wissen sollte, was ich antworten soll. Nämlich, dass ich fremd bin.
Allerdings konnte ich nicht leugnen, dass meine Lebenswelt doch eine andere war als die derjenigen, deren Deutschtum nicht regelmäßig infrage gestellt wird. Eine mit mehr Herabwürdigungen meiner Leistung, eine mit mehr grenzüberschreitenden Ratschlägen oder überheblichen Kommentaren und eine mit mehr Respektlosigkeiten. Mein starres Beharren, nicht anders zu sein, ließ keinen Platz, die Gerichte zu erlernen, die ich von meiner Mutter gekocht liebte, keinen Platz, Filme in einer Sprache zu schauen, die ich mal konnte oder in die Herkunftsländer meiner Eltern zu reisen. Ich weigerte mich, dem Stereotyp ähnlicher zu werden, das mich so entmenschlichte.
Gleichzeitig gab es kein Entkommen. Mein Partner wollte gerne essen wie bei meinen Eltern, ich interessierte mich vor allem für die Erzähltraditionen, die Motive meiner Hong Konger und japanischen Kindheitsserien aufgriffen und irgendwann hoffte ich, wenn ich schon hier nicht als normaler Teil der Gesellschaft angenommen werde, gäbe es zumindest in Hong Kong – einer Stadt mit einer hybriden chinesisch-britischen Identität – ein Plätzchen für mich. Die Sehnsucht nach Zugehörigkeit stieg und konnte nicht durch meine einseitige Bekundung allein erfüllt werden. Nicht solange ich ständig als fremd markiert wurde.
„Anders, aber nicht so“
Die People of Colour, die ich aus meinem Umfeld kannte, hatten meist ein resigniertes Verhältnis mit den Sprüchen und Witzen gefunden. Viele leugneten sie oder spielten sie mit einem Schulterzucken herunter. Mein Unwohlsein mit ihnen zu besprechen, bedeutete meist als überempfindlich zu gelten oder als naiv, nicht genügend Erfahrungen gemacht zu haben, um zu erkennen, dass es „nun mal so ist“. Es war selbst unter ihnen isolierend, sich zu weigern „fremd in Deutschland“ zu sein.
Mit der erhöhten Sichtbarkeit von Mitgliedern der vietnamesischen Diaspora der zweiten Generation in den Medien – von MaiLab über Nhi Le zu Vanessa Vu – begann ich mich zum ersten Mal mehr als Teil einer größeren Gruppe zu fühlen. Zunächst las ich ihre Artikel und sah mir ihre Videos aufgrund der jeweiligen Themen an. Über kurz oder lang fand ich darunter auch ihre unterschiedlichen Positionen zu Themen der Diaspora und las wie gebannt ihre Erfahrungsberichte und wie sie zu Stereotypen, zu Rassismus oder Interkulturalität standen. Anders als ihre KollegInnen ohne („sichtbaren“) Migrationshintergrund hatten sie einen reichen Erfahrungsschatz mit Alltagsrassismus vorzuweisen sowie sich eine Strategie im Umgang mit ihm zurechtgelegt. Ich hoffte, von ihnen lernen zu können, weil mir ähnliches widerfahren war. Ich erkannte, dass ich nicht allein mit diesen Erlebnissen war und dass sie nicht nur in meiner Kleinstadt geschahen, sondern ein landesweites Problem waren. Durch diese geteilten Erlebnisse ist es möglich sich zu vernetzen und auszutauschen.
Zu einer Identität, zu einem „Label“, in der ich mich vollständig aufgehoben fühlte, kam ich erst, als ich lernte, differenziert zu benennen was mir geschehen war. Erst als ich lernte, dass mein Unwohlsein nicht als meine Empfindlichkeit interpretiert werden muss, sondern auch durch die Mikroaggression meines Gegenübers verursacht sein kann, konnte ich innerlich aus der Rolle des duldenden, verzeihenden, Verständnis für alles aufbringenden Gastes in Deutschland ausbrechen. Erst als ich die die einzelne Situation übergreifende systematische Diskriminierung gegen Menschen meines Aussehens erkannte, verstand ich, dass nicht unbedingt die einzelne Person versagt hat, die mit den Konsequenzen der Ausgrenzung leben muss, sondern dass wir in einer rassistischen Kultur aufwachsen, die Privilegien ungerecht verteilt.
Adäquat über systematische Machtungleichheit sprechen zu können, ist Voraussetzung für politische Meinungsbildung und Handlungsfähigkeit. Als eine Kommentatorin der Zeit die Berichterstattung im Nachgang der Chemnitzer Hetzjagd auf nichtweiße Passanten kritisierte, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. „Fremden-“ und „ausländerfeindlich“ nannten sie die Ausschreitungen. Die Autorin fragte rhetorisch, ob die Angreifer denn nach Ausweis, Schulzeugnissen oder Geburtsurkunde gefragt hätten, bevor sie zuschlugen. Die Gewalt gegen jeden, dem man einen noch so entfernten nichtweißen Vorfahren ansieht, ohne Not als Gewalt gegen Ausländer und daher Fremde zu bezeichnen, versetzt den Sprechenden in eine Position, die dem Angreifer näher ist als dem Opfer. Hier eingesetzt suggerieren diese Begriffe eine gemeinsame Zugehörigkeit zu einer Gruppe, aus der der Mensch mit den unpassenden äußerlichen Merkmalen ausgeschlossen wird. Selbst diejenigen, die die Gewalt gegen ihn kritisieren, betrachten ihn somit aus der Perspektive des Aggressors oder geben sich zumindest keine Mühe, sich solidarisch an seine Seite zu stellen. Diese Sprache korreliert mit der Untätigkeit großer Bereiche der Gesellschaft, die nach den gehäuften rassistischen Gewalttaten der letzten Jahre noch immer fragen, ob es Rassismus in Deutschland überhaupt gebe. Wie sollen sie ihn erkennen, wenn sie ständig davon ausgehen, dass diese Art von Gewalt nur Ausländer, keine Deutschen betreffe? Wenn Fremde betroffen sind, ist Mitleid gefragt, wenn es Gruppenmitglieder sind, Aktivität. So erklärt sich auch, dass öffentlich mit großer Zustimmung Zuhören und Entgegenkommen verlangt wird, wenn Pegida- und AfD-Anhänger Sorgen vor Überfremdung haben. Es jedoch gleichzeitig – wenn sie überhaupt zur Sprache kommen – herablassend als Empfindlichkeit kommentiert oder nach kurzer Betroffenheit ignoriert wird, wenn People of Colour in Berlin, Chemnitz oder Hanau sagen, dass sie sich nicht auf die Straße trauen. Natürlich gibt es auch Ausländer- und Fremdenfeindlichkeit, sie jedoch synonym mit Rassismus zu verwenden, verkennt ihren Kern.
Erst als ich verstand, dass es rassistisch ist, mir hinterher zu rufen, ich solle aus Deutschland verschwinden, genauso wie zu unterstellen meine Gene würden mich schlank halten, konnte ich die historischen Kontexte recherchieren, in denen die Andersbehandlung asiatischer Menschen begründet wurde, die die Stereotypen von heute produzierten. So erst verstand ich, dass es nicht genügt, privat Strategien mit interpersonellem Rassismus zu entwickeln, sondern es eine gesellschaftliche Aufgabe ist, antirassistisch zu werden. Nicht nur hilft es Betroffenen, sich auszutauschen und den Umgang mit Ausgrenzung und Herabwürdigung zu erlernen. Es motiviert mich, zu sehen, wie viele Menschen gerade dieses Jahr ihre Stimme erheben, um die Ungerechtigkeit anzuprangern, dass noch immer Menschen aufgrund ihrer rassistischen Zuschreibung diskriminiert werden. Es motiviert mich, dass ich mich dadurch in Gesprächen immer seltener rechtfertigen muss, dass ich eine süddeutsche Stadt als meine Herkunft nenne, dass Menschen lernen nach meiner Familie, der Herkunft meines Namens oder meiner Ethnie zu fragen oder dass einzelne Menschen mir solidarisch beistehen, wenn jemand grenzüberschreitend wird. Der neue grundsätzliche Respekt meiner Meinung und Gefühle verdanke ich zum Teil dem veränderten sozialen Klimas, das auch die ethnischen Minderheiten dieses Landes als Teil der Gesellschaft betrachtet, ihre Selbstbezeichnung und ihre Ängste und Hoffnungen achtet. Zum anderen Teil half mir auch das Erkennen meiner eigenen Identität. Sie ist nicht identisch mit meinen Wurzeln, sondern beruht vor allem auf meinem Leben, meiner Sozialisation und meinen Werten. Ich nenne mich nun eine kantonesisch-vietnamesische Deutsche. Ich bin Teil der asiatischen Diaspora in Deutschland. Ich bin eine Person of Colour.
Meine Namen sind Christine Vo, Võ Tố Trinh und 武 素 貞.
Dieser Artikel ist einer von zahreichen Beiträgen, die bei unserem „Call for Contributions“ eingereicht wurden, aber aufgrund der begrenzten Kapazität nicht in unserer neuesten Publikation „Ist Zuhause da, wo die Sternfrüchte süß sind? Viet-deutsche Lebensrealitäten im Wandel“ abgedruckt werden konnten. Wir freuen uns, ihn hier veröffentlichen zu können.
Über die Autorin
Christine Vo studiert, nachdem sie parallel den Bachelor in Psychologie abgeschlossen hat, nun noch Medizin in Tübingen. 1995 in einer Kleinstadt in Süddeutschland geboren, wuchs sie als Tochter einer ethnischen Chinesin aus Vietnam und eines Boat-People-Vietnamesen dreisprachig in einem von Alltagsrassismus und ständiger Bemühung um Integration geprägten Umfeld auf. Fasziniert beobachtet sie die seit einigen Jahren steigende Sichtbarkeit vieler Asiat*innen in verschiedensten Medien und sieht diesen Blogeintrag als eine tolle Chance an dazu beizutragen. Sie liebt Last Week tonight with John Oliver, zeichnet Comics und trifft außerhalb des Lockdowns gerne FreundInnen.
In den sozialen Medien findet Ihr sie unter: https://www.instagram.com/soujing.art/